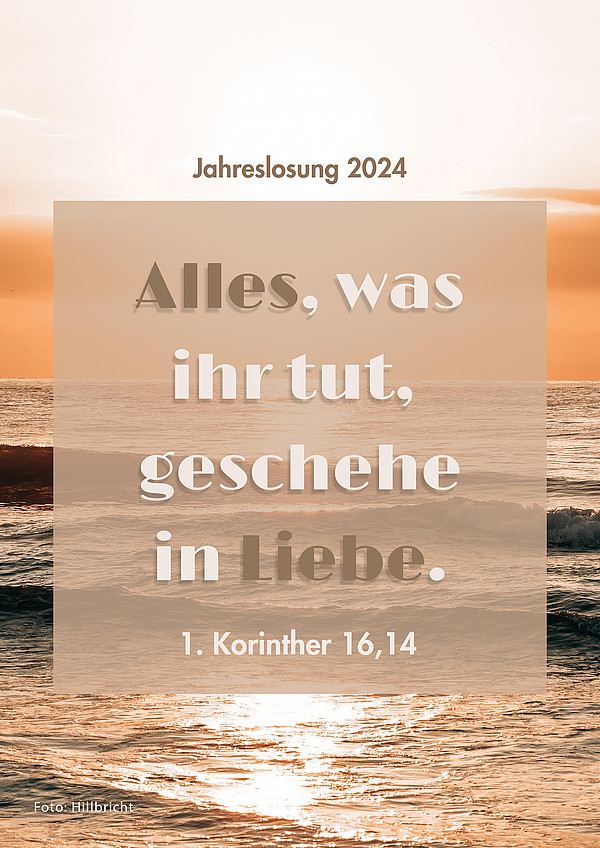Glauben Juden, Christen und Muslime an denselben Gott?
Die drei montheistischen Religionen sind durch viele Gemeinsamkeiten ...
Die drei monotheistischen Religionen sind durch viele Gemeinsamkeiten und die Überzeugung verbunden, dass es nur einen Gott gibt. Aber schon unter Christ*innen besteht keine Einigkeit darüber, wie Gott recht zu verehren ist und wie wir seinem Willen gemäß leben.
Im Zentrum der drei Religionen Judentum, Christentum und Islam steht das Bekenntnis, dass es nur einen Gott gibt. Darum werden sie auch die monotheistischen Religionen genannt (griechisch: monos theos = ein einziger Gott). Sie teilen nicht nur die Überzeugung, dass es nur einen Gott gibt. Sie teilen auch viele Traditionen und Überzeugungen, wer und wie Gott ist: der Schöpfer der Welt, ihr Richter und Erlöser. Er lässt die Menschen seinen Willen wissen, damit ihr Zusammenleben gelingt. Gott tröstet und ermutigt die Menschen und befähigt sie zu gelingendem Leben. Auch geschichtlich verbindet Judentum, Christentum und Islam viel. Sie haben dieselben Quellen und sich in ihrer Entwicklung immer wieder beeinflusst. Ja, mit dem Judentum teilen wir den größeren Teil der Heiligen Schrift, das Erste Testament.
Bei all diesen Gemeinsamkeiten: Glauben Muslime, Juden und Christen an denselben Gott? Würden sie an verschiedene Götter glauben, müssten sie ihrem zentralen Glaubensbekenntnis widersprechen. Dann müsste es drei Götter geben. Bleibt die Möglichkeit, dass nur die Anhänger*innen einer Religion dem Glauben an den einen Gott treu geblieben sind und die anderen mit ihrer Religion auf dem Holzweg sind. Diesen Vorwurf gibt es auf allen Seiten. Aber Religionen werden von Menschen geprägt und gelebt. Wie können wir sagen, die eine sei wahr und die andere falsch? Wahr und ewig ist Gott allein. Aber es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten, an Gott zu glauben und mit ihm zu leben. Schon unter Christ*innen besteht keine Einigkeit darüber, wie Gott recht zu verehren ist und wie wir seinem Willen gemäß leben. Diese Vielfalt kann aber auch als Reichtum erlebt werden. Gerade deshalb können und sollen wir unseren christlichen Glauben fröhlich und offen bekennen – gegenüber nicht gläubigen Menschen, aber auch gegenüber Jüd*innen und Muslim*innen.
Judentum, Islam und Christentum sind aber auch nicht „irgendwie dasselbe“. Sie unterscheiden sich in vielen Dingen. Jesus, die Propheten und Erzväter kommen auch im Koran vor, werden aber zum Teil ganz anders geschildert.
Christ*innen glauben an Gottes Sohn: dass Gott sich an die Worte und Taten, den Tod und die Auferstehung seines Christus Jesus gebunden hat. Sie glauben an die Heilige Geistkraft: Sie erfahren, dass Gott bis heute an ihnen handelt und ihre Gemeinschaft stärkt. Wir brauchen die Unterschiede zum Islam und zum Judentum nicht unter den Teppich zu kehren. Aber wir müssen sie nicht als Besserwisserei oder gar zur Abgrenzung von den Menschen verwenden, die anders an den einen Gott glauben.
Zum Glaubensbekenntnis aller drei Religionen gehört, dass Menschen auf Gott vertrauen, dass sie das Gerechte tun, ihren Mitmenschen und dem Frieden dienen. Bleiben sie Gott und ihren Mitmenschen dieses Vertrauen und diesen Dienst schuldig, entfernen sie sich von Gott und seinem Willen. In diesem Sinne glauben sie dann nicht an den einen Gott, den alle drei Religionen bekennen.
Markus Schaefer
Quelle: EKiR.info 1/2024